Wohngeld 2025: Welche Kosten werden gefördert?
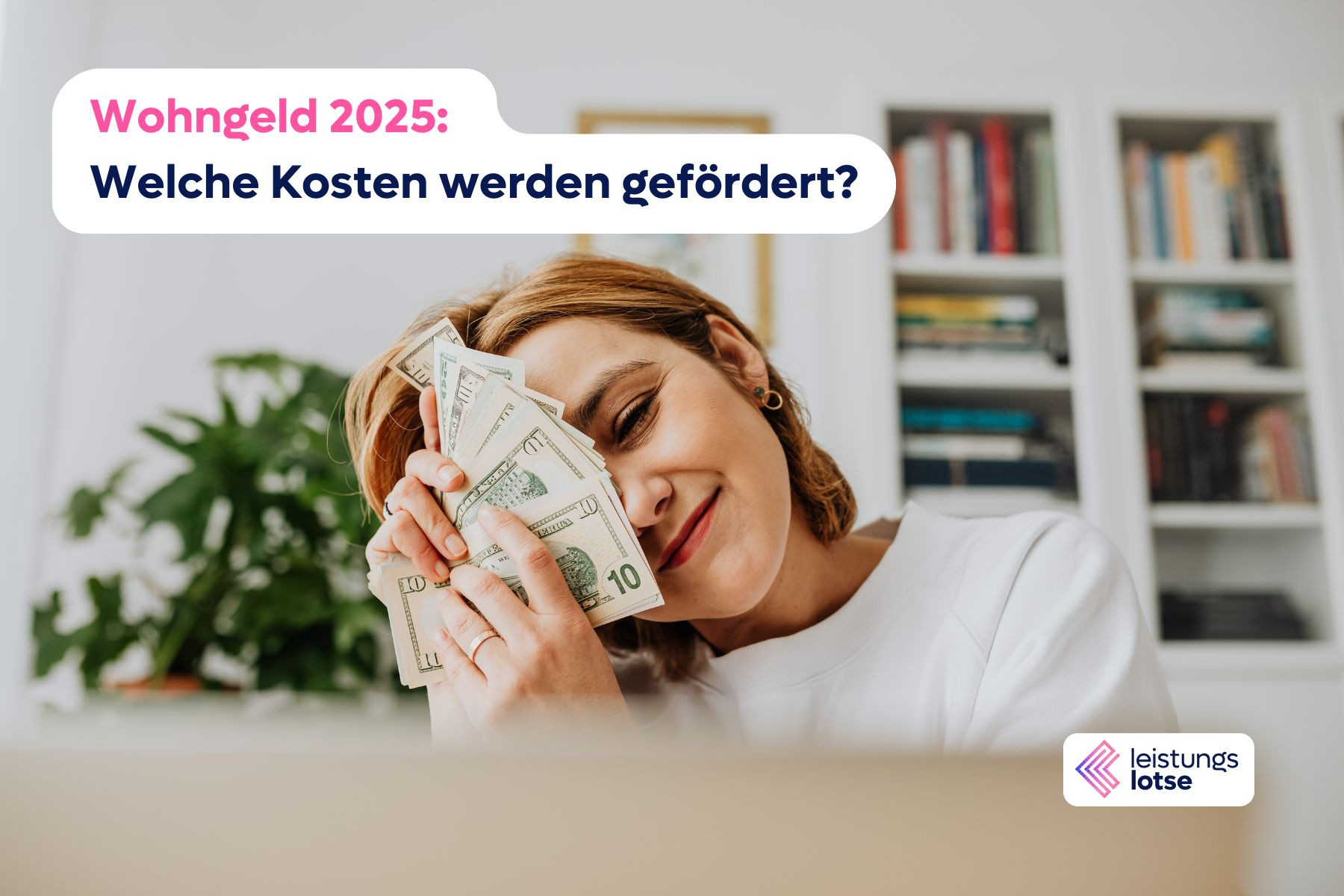
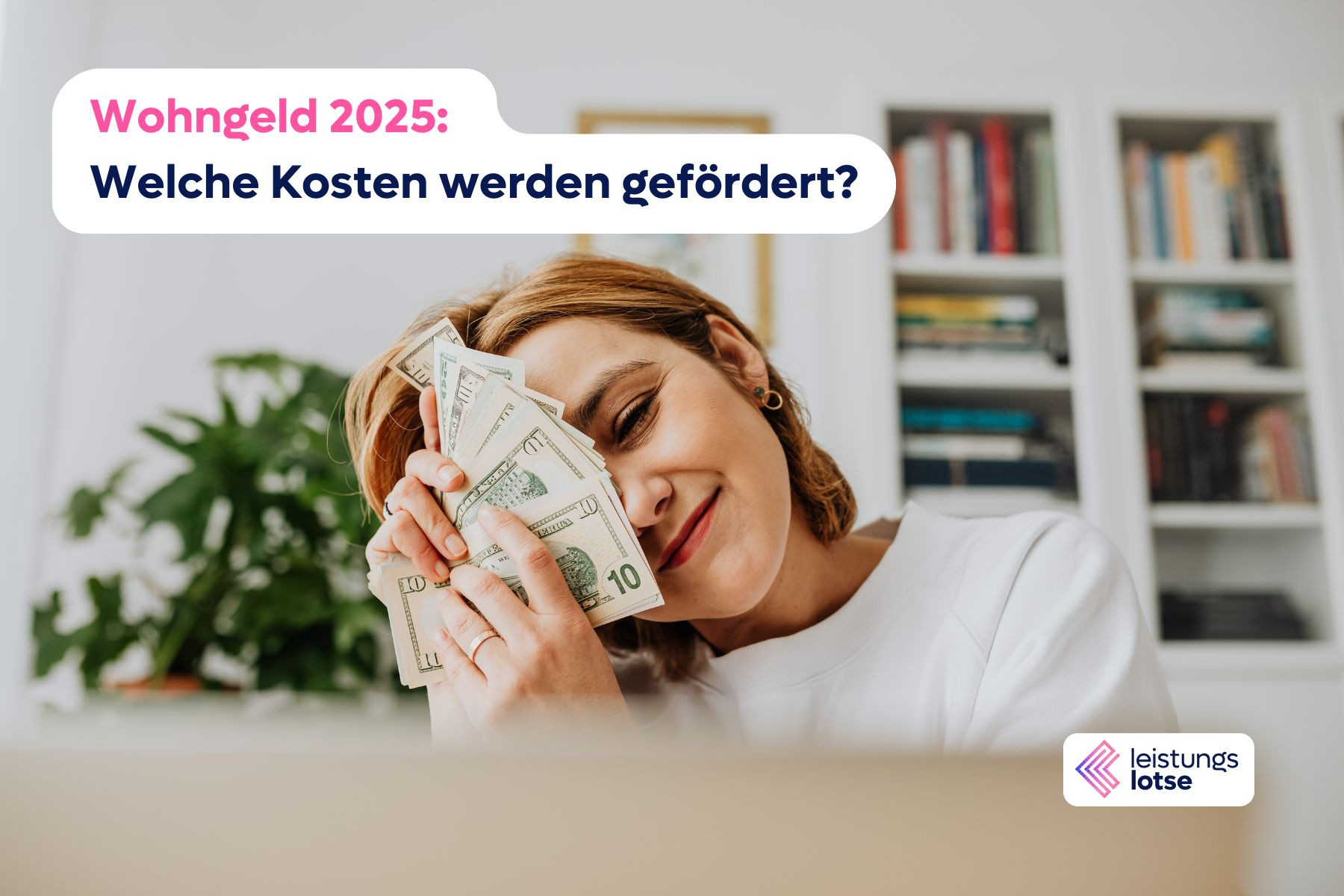
Das Wohngeld ist eine staatliche Leistung, die einkommensschwache Haushalte bei den Wohnkosten unterstützt. Mit der Wohngeldreform 2023 wurde die Leistung grundlegend überarbeitet, um mehr Menschen den Zugang zu ermöglichen. Ab dem 1. Januar 2025 steht eine weitere Erhöhung des Wohngeldes an. Dieser Artikel gibt einen Überblick über die aktuellen Änderungen, die Beantragung sowie ergänzende Leistungen und verwandte Wohnraumförderungen.
Finde schnell und einfach heraus, ob du Anspruch auf Wohngeld hast und wie viel du bekommen könntest.
Dies ist eine Schätzung. Der tatsächliche Betrag kann abweichen.
Basierend auf deinen Angaben hast du wahrscheinlich Anspruch auf Wohngeld!
Basierend auf deinen Angaben steht dir wahrscheinlich kein Wohngeld zu.
Mit uns kannst du deinen Antrag ganz bequem abschicken.
Jetzt beantragen!Für Antragsteller, die einen Mietzuschuss erhalten möchten, ist es entscheidend zu verstehen, was rechtlich unter dem Begriff „Miete“ fällt. Laut § 9 des Wohngeldgesetzes (WoGG) umfasst die Miete das Entgelt für die Überlassung von Wohnraum, sei es durch Miet-, Untermiet- oder vergleichbare Nutzungsverträge. Dabei beschränkt sich die Miete nicht nur auf die reine Monatsmiete, sondern schließt auch Umlagen und Zuschläge ein, wie beispielsweise Kosten für Wasser, Müllentsorgung oder Treppenbeleuchtung. Es ist unerheblich, ob diese Zahlungen direkt an den VermieterInnen oder an externe Dienstleister erfolgen.
Für den Mietzuschuss werden bestimmte Kosten nicht als Miete berücksichtigt. Dazu gehören:
Kosten für Heizungs- und Warmwasseranlagen sowie Fernwärmekosten
Untermietzuschläge, die der/die MieterIn an den VermieterIn zahlt
Gebühren für die Nutzung von Waschmaschinen, Kühlschränken oder Möbeln, die vom VermieterIn bereitgestellt werden
Mietanteile für Wohnraum, der untervermietet oder gewerblich genutzt wird
Zahlungen für die Nutzung einer Garage, eines Stellplatzes oder eines Gartens
Beachte: Wichtig ist, dass die Miete sich aus dem Mietvertrag oder ergänzende Unterlagen (zB Erhöhungsschreiben) ergibt und nachgewiesen werden kann.
Zum 1. Januar 2025 wurde das Wohngeld erhöht, um steigende Miet- und Energiekosten auszugleichen. Diese Erhöhung folgt der bereits 2023 eingeführten Wohngeldreform, die eine deutliche Ausweitung des Berechtigtenkreises brachte. Ziel der Reform ist es, mehr Haushalte finanziell zu entlasten und ihnen den Verbleib in ihren Wohnungen zu ermöglichen.
Mit der Wohngeldreform 2023 wurde eine Heizkosten- und Klimakomponente eingeführt. Die Heizkostenkomponente berücksichtigt die steigenden Energiekosten und sorgt für eine gezielte Entlastung von Haushalten mit niedrigen Einkommen. Die Klimakomponente soll helfen, energetisch sanierte Wohnungen bezahlbarer zu machen. Dadurch profitieren vor allem MieterInnen in Wohngebäuden, die auf nachhaltige Energien umgestellt wurden.
Ein wichtiger Aspekt der Reform ist die sogenannte Dynamisierung des Wohngeldes. Dabei handelt es sich um eine automatische Anpassung der Leistung an die Miet- und Einkommensentwicklung. Diese Dynamisierung soll verhindern, dass das Wohngeld durch Inflation oder steigende Mietpreise an Kaufkraft verliert und somit für die Berechtigten dauerhaft eine wirksame Unterstützung bleibt.
Die Bundesregierung ist gesetzlich verpflichtet, regelmäßig Berichte über die Entwicklung des Wohngeldes und der Mieten vorzulegen. Diese Berichte dienen als Grundlage für politische Entscheidungen zur Anpassung der Wohnraumförderung. Sie enthalten unter anderem Daten zur Anzahl der Wohngeldempfänger, durchschnittlichen Mietkosten und den Auswirkungen der jeweiligen Reformen.
Wohngeld kann bei der zuständigen Wohngeldbehörde der jeweiligen Stadt oder Gemeinde beantragt werden. Der Antrag ist formfrei möglich, also kann auch per E-Mail eingereicht werden. Es müssen aber Nachweise über Einkommen, Mietkosten und Haushaltszusammensetzung etc. beigefügt werden. Die Nachweispflichten sind sehr umfassend.
Du musst noch Wohngeld beantragen? Mit unserem Wohngeld-Rechner von LeistungsLotse kannst du schnell und einfach prüfen, ob und wie viel Wohngeld dir zusteht. Jetzt prüfen!
Neben dem Wohngeld gibt es weitere staatliche Unterstützungen, die in Verbindung mit Wohnkosten stehen. Dazu zählen:
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Menschen mit sehr geringem Einkommen können zusätzlich zur Grundsicherung Wohngeld erhalten.
Kinderzuschlag: Eltern mit niedrigem Einkommen können neben Kindergeld und dem Wohngeld auch den Kinderzuschlag beantragen.
Elterngeld: Der Betrag des Elterngeldes, der den Mindestbetrag (300 Euro bei Basiselterngeld oder 150 Euro bei Elterngeld-Plus) übersteigt, wird wie Einkommen angerechnet.
Neben dem Wohngeld gibt es weitere Maßnahmen zur Wohnraumförderung. Die soziale Wohnraumförderung stellt bezahlbaren Wohnraum für einkommensschwache Haushalte bereit. In vielen Städten gibt es spezielle Programme zur Mietpreisbindung, um bezahlbare Wohnungen zu sichern.
Eine weitere Möglichkeit ist das genossenschaftliche Wohnen, bei dem MieterInnen gleichzeitig MitgliederInnen einer Wohnungsgenossenschaft sind. Dies bietet langfristige Wohnsicherheit und häufig günstigere Mieten als auf dem freien Wohnungsmarkt.
| Features |
 Empfohlen
Empfohlen
|
Staatliche Antrags-Dienste | Andere private Dienste |
|---|---|---|---|
| Einfache, verständliche Antragstellung |
|
|
|
| Prüfung der jeweiligen Voraussetzungen mit Rechner & Lotsen |
|
|
|
| Digitale Weiterleitung an die zuständige Behörde |
|
|
|
| Keine Mehrfacheingaben |
|
|
|
| Sicheres digitales Verfahren mit hohem Datenschutzstandard |
|
|
|
| Alle Leistungen in einem Portal |
|
|
|

Mit uns kannst du deinen Antrag ganz bequem abschicken.
Jetzt beantragen!Das Wohngeld ist eine wichtige Unterstützung für einkommensschwache Haushalte und wird ab 2025 erneut erhöht. Die Reformen der letzten Jahre, darunter die Heizkosten- und Klimakomponente sowie die Dynamisierung, sorgen für eine bessere Anpassung an steigende Wohnkosten. Neben Wohngeld gibt es ergänzende Leistungen wie Grundsicherung oder Kinderzuschlag. Zudem bieten soziale Wohnraumförderung und genossenschaftliches Wohnen weitere Möglichkeiten für bezahlbaren Wohnraum. Die Beantragung erfolgt bei den zuständigen Wohngeldbehörden, teils auch online. Regelmäßige Berichte der Bundesregierung helfen, notwendige Anpassungen vorzunehmen. Wer sich frühzeitig informiert, kann finanzielle Entlastung optimal nutzen. So bleibt Wohngeld auch in Zukunft eine zentrale Säule der Wohnraumförderung.
Du musst noch Wohngeld beantragen? Mit unserem Wohngeld-Rechner von LeistungsLotse kannst du schnell und einfach prüfen, ob und wie viel Wohngeld dir zusteht. Jetzt prüfen!
Hier kannst du anonym Fragen stellen, die öffentlich beantwortet werden. Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht und dient nur dazu, dich über die Antwort zu benachrichtigen.

Ist Wohngeld nur für Studierende ohne BAföG Anspruch? BAföG geht in der Regel vor. Wann du trotzdem Wohngeld erhältst erfährst du hier.

Wohngeld oder Bürgergeld? Erfahre die Unterschiede, wer Anspruch hat und welche Leistung für dich am besten ist. Jetzt die richtige Wahl treffen!

Wer hat Anspruch auf den Wohngeld-Mietzuschuss? Infos zu Einkommensgrenzen, Antragstellung und Online-Abwicklung. Jetzt Wohngeld prüfen!

Der Wohngeld Lastenzuschuss hilft EigentümerInnen mit geringem Einkommen bei den Wohnkosten. Erfahre, wer Anspruch hat & wie du ihn beantragen kannst!